[Dieser Artikel ist auch im ➛Weltenportal Nr. 3 04/2022, S 79-83 (Hg. Christoph Grimm) erschienen.]
Viele in meiner Generation sind mit Gustav Schwabs (Die schönsten) Sagen des klassischen Alterthums (1838-40) groß geworden. Der schwäbische Pfarrer erzählt fast die gesamte griechische Mythologie kindgerecht (und „für Frauen“) in 3 Bänden nach und wurde damit weltweit bekannt. Und auch die nächste Generation, meine Kinder, sind mit Achill, Hektor, Odysseus, Circe, den Zyklopen, all den großen Helden und Monstern bestens vertraut.
Haben diese alten Geschichten womöglich in jeder Zeit etwas zu sagen?
Klingt jedenfalls gut, wenn man als Roman-Autor gerne darauf zurückgreift. „Mythen haben mich schon immer fasziniert“, verrät uns einer der berühmten, Neil Gaiman, in dem festen Glauben, dass sie „etwas grundlegend Lebendiges sind, mit dem man arbeiten kann.“ (Beobachtungen 78). Deshalb sieht er einen „wichtigen“ Teil seiner schriftstellerischen Tätigkeit darin, „Mythen immer wieder zu erzählen“ (Beobachtungen 81). „Diese Geschichten haben Macht“ (Beobachtungen 85). „Tatsächlich sind sie das Wichtigste, was es gibt“ (Beobachtungen 40).
All diese klugen Dinge hat der in Südengland geborene Autor, der übrigens alle Preise abgeräumt hat, die es für Comics und fantastische Literatur zu gewinnen gibt, zu verschiedensten Anlässen (Awards, Einleitungen) zum Besten gegeben, zusammengefasst in angelsächsischem Stil in einer Essaysammlung: Beobachtungen aus der letzten Reihe mit dem bezeichnenden Untertitel „… und wieso wir Geschichten brauchen“.
Als ich diese Essays gelesen habe, ging mir ein Licht auf, warum Gaimans Bücher ein so breites Publikum weit über die Fantasy hinaus erreichen. Es ist sein spezieller Stil, dass er immer mit gehaltvollen, oft mythologischen Stoffen experimentiert und diese in moderne Geschichten einbindet. Das macht er in unnachahmlicher Weise. Und ich habe eine Idee bekommen, warum mir persönlich viele seiner Romane nicht gefallen. Beides versuche ich zu erklären.
Aus dem Nähkästchen des Erfolgsautors
„Ich werde euch ein Geheimnis unseres Handwerks verraten“, vertraut uns der Erfolgsautor an. „Es geht um den Zaubertrick, auf dem alle guten Geschichten beruhen (…).“ Tata … jetzt kommt‘s: „Die Dinge haben nicht immer nur eine wörtliche Bedeutung, sondern meistens bedeuten sie mehr.“ (Beobachtungen 296).
Hm … Mehr an Bedeutung … – Wie meint er das genau? – Ich habe weiter nachgelesen:
Erstens muss der „Leser“ „Teil der Magie“ werden, indem er „sich selbst einbringt“ und „sich sein eigenes Buch“ baut, und zwar indem der Autor vieles „nicht“ erzählt (Beobachtungen 225, 60).
Zweitens geht es darum „Geschichten zu erzählen, die Gewicht und Bedeutung haben“, wie die über „Götter und Mythen“, eine „Literatur der Vorstellungskraft“. Dann gelingt es, „Dinge von Bedeutung zu vermitteln“ (Beobachtungen 231).
Zwei hilfreiche Ansätze
Erlaubt mir zwei Absätze Theorie, um das schriftstellerische Konzept von Neil Gaiman besser greifbar zu machen.
Menschliches Verstehen setzt immer voraus, dass etwas sinnvoll ist, was der Psychologe Hans Hörmann (1924-1983) „Sinnkonstanz“ (Meinen und Verstehen, 1976) nennt. Jeder Text, jede Äußerung ist durch die sprachlichen Ausdrücke unzureichend festgelegt im Sinngehalt. Wie ein „Sog der Erwartung“ (208) konstruiert das menschliche Gehirn als „aktive Leistung“ (210) die Bedeutung aus der eigenen Sichtweise.
Auf literarische Texte bezogen hat Wolfgang Iser (1926-2007) auf dieser Basis die Theorie der „Leerstellen“ (Der Akt des Lesens, 1984) entwickelt, die eine „Besetzbarkeit einer bestimmten Systemstelle im Text durch die Vorstellung des Lesers“ (284) meint.
Beides miteinander verknüpft heißt: Als Leser*in konstruieren wir immer mithilfe unserer Fantasie die Bedeutung eines Textes, weil Sprache grundsätzlich nicht alles festlegt. Dieses Mittel lässt sich aber auch bewusst steigern, indem Metaphern, offene Bilder, Andeutungen, Verweise, bewusste Brüche, Symbolträchtiges, mythologisch geprägte Elemente u.v.m. verwendet werden, die eine Projektionsfläche für Bedeutung schaffen und dem Leser das Gefühl vermitteln, dass seine eigene Welt sich darin widerspiegelt.
Wenn dies auf eine geschickte Weise gelingt, wird man ein Werk als „poetisch“ oder „episch“ wahrnehmen. Wenn nicht, kann es auch überzogen wirken und man denkt: was ein idiotischer Fantasy-Mist.
Schauen wir uns doch mal das Romandebüt von Neil Gaiman aus dem Jahr 1996 daraufhin an.
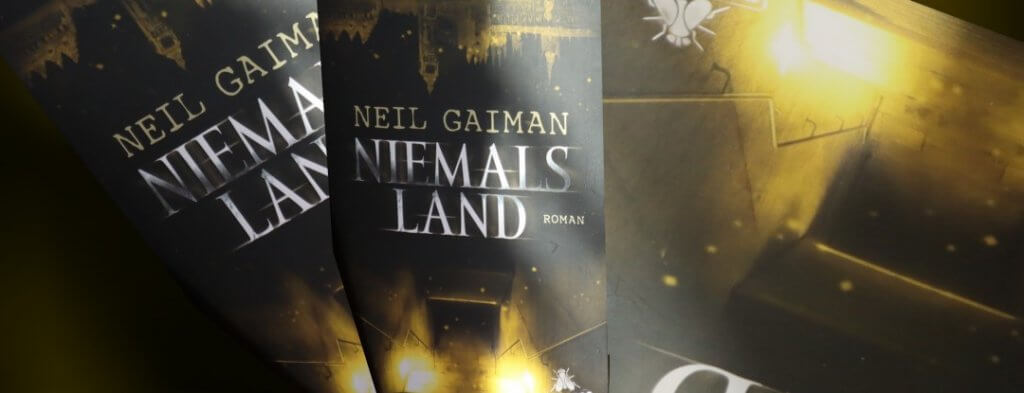
„Fragst du dich auch manchmal, ob das hier alles ist?“ (Niemalsland 384), grübelt Richard, nachdem er sein altes Leben wiederhat, Penthouse in London, Junior Partner bei der Arbeit, Verlobte inbegriffen. Inzwischen hatte er in dem London unter der Stadt so viel Unglaubliches erlebt, dass ihm das normale Leben fragwürdig erscheint. Aber beginnen wir vom Anfang.
Der Mittzwanziger Richard kommt als Wertpapierhändler nach London, wird von dem Großtstadttreiben vereinnahmt wie auch von einer toughen Frau, die selbst noch erfolgreicher ist und ihn für die Liebe und Museumsbesuche nutzt. Plötzlich fällt ihm eine mädchenhafte Frau (Door) vor die Füße, schmutzig und schwer verletzt, die er vor ihren Verfolgern versteckt und versorgt. Diese barmherzige Tat hat fatale Folgen. Seine Verlobte gibt ihm den Laufpass. Und er wird in Doors Angelegenheiten verwickelt, die ihn durch einen Kanaldeckel auf die Dächer eines anderen London, des Unterlondon führen, wo er einen windigen Typen, den Marquis de Carabas, für sie anheuern soll. Als er zurückkehrt, kennt Richard niemand mehr. Sein Leben in „Ober“-London ist wie ausgelöscht.
Ihm bleibt nichts anderes, als Door zu suchen, in der Hoffnung, dass sie etwas an seinem verlorenen Leben ändern kann. Eine aristokratische Ratte bringt ihn nach Unterlondon, wo er von der Rattensprecherin Anaesthesia zu einem schwimmenden Markt begleitet wird. Als er dort schließlich Door trifft, die in dem dunklen und armen Unterlondon bekannt ist und nach den Mördern ihrer Familie fahndet, schließt er sich ihr erst einmal an. Mit einer Leibwache, Hunter, und dem Marquis de Carabas finden sie den Weg zum Engel Islington, der ihnen für einen Schlüssel alles verspricht (das hätte einem zu denken geben können, schließlich weiß man, dass auch Engel fallen können!).
In einem Kloster wartet eine Prüfung auf die drei, bevor sie den Schlüssel erhalten. Richard als letzter wird mit seinen Schatten konfrontiert, ein Verlorener zwischen den Welten zu sein, aber er besteht. Auf dem Weg zurück zum Engel, dem sie den Schlüssel bringen wollen, müssen die drei durch ein Labyrinth, ein Monster besiegen, um dann der bitteren Wahrheit ins Auge zu sehen, dass es der gefangene Engel Islington war, der auf Door das brutale Mörder-Pärchen angesetzt hat, die sie verfolgten und das ihre Familie ausgelöscht hat.
Tja. Auch Engel lassen sich überlisten, und mit dem Schlüssel, der der „Schlüssel zur ganzen Realität“ (Niemalsland, 360 f) ist, gelangt Richard wieder in sein Ober-London und die eigene Welt zurück. Aber dort gefällt es ihm jetzt nicht mehr …
Die Handlung webt sich um alle bekannten und unbekannten U-Bahn-Stationen in London und wird damit zu einer Art Tube-Queste. Neverland ist Neil Gaimans erster Roman aus dem Jahr 1996, als er sich mit den „Sandman“-Comics bereits einen Namen gemacht hatte. „(…) ich wollte von den Menschen erzählen, die durchs Raster fallen, zum ersten Mal von den Besitzlosen erzählen – mit dem Spiegel der Fantasy, der uns manchmal Dinge zeigt, die wir schon so oft gesehen haben, dass wir sie nicht mehr wirklich sehen“ (Niemalsland, 8 f.).
Ganz ehrlich: Ich habe selten in einem Buch so wenig von den Details verstanden wie in diesem. Szenenwechsel wie am Bahnsteig vorbeirauschende Züge, eine Rattenplage an Logikbrüchen, aus dem Dunkel der Schächte auftauchende Zombies, Vampire, Bestien, Engel und Helden. Und immer wieder U-Bahn-Stationen, deren Namen symbolisch für die Handlung werden.
Neil Gaimann verquickt in diesem Roman hemmungslos und wild Londoner Realitäten mit Elementen aus allen möglichen Geschichten, Symbolen und Mythen. Zugutehalten muss ich ihm, dass er dabei feinsinnig alle kleinen Stränge im Blick behält, so dass alles verknüpft wirkt, auf der erzählerischen Ebene wie ein Ganzes erscheint und rund wirkt.
Wird diese Stimmigkeit nur suggeriert? Ist es künstlerisches Raffinement, meiner inneren „Sinnkonstanz“ durch fest ineinander verwobene Erzählfäden Sinnhaftigkeit vorzugaukeln? Im Einzelnen bleiben die Elemente nämlich lose, offen für alles Mögliche, was man hineinlesen mag. Nur um einen kleinen Eindruck zu vermitteln:
Der Engel Islington – eine Erzengelfigur vor einem Gasthaus im Stadtteil Islington – ist ein Büßender für den Untergang von Atlantis, „Door“ sinnigerweise eine Türöffnerin, der Marquis de Carabas ein alter Name für den Gestiefelten Kater. Anaesthesia, die Begleiterin, bedeutet griechisch Empfindungslosigkeit. Die Bestie herrscht im Labyrinth, versperrt den Zugang zum Engel wie der Minotaurus und nur ihr Jäger (namens „Hunter“) kann sie mit dem einen Speer (Heilige Lanze) töten. Das Blut der Bestie wird für symbolische Handlungen genutzt (Benetzung von Stirn und Zunge). Mansfieldpark von Jane Austin taucht mehrfach auf. Ein geheimnisvolles „Kästchen“ erweckt jemanden von den Toten. Zwei grobschlächtige Assassinen, die angedeutet schon Jesus kreuzigten, essen den Inbegriff von Kultur, eine Ming-Vase …
Es ist endlos und die Aufzählung nur ein Bruchteil. Vermutlich habe ich zudem nur einen Teil aller Mythen und Symbolik bewusst wahrgenommen, die zu einem Mehr an Bedeutung einladen …
Ist diese Ansammlung von bedeutungsoffenen Elementen eine Überfrachtung oder ein „Schlüssel zur gesamten Realität“ (Niemalsland, 361), gar eine poetische Pforte in himmlische Gefilde?
Bei „Neverland“ habe ich in meinem eigenen Horizont, eine Anschließbarkeit für all diese bedeutungsvollen Elemente gefunden. Ich liebe London, seine U-Bahnstationen und die „Vorstellung, dass es weitere Welten unter dieser gibt, dass London magisch und gefährlich ist und dass die unterirdischen Tunnel so abgelegen, geheimnisvoll und vermutlich auch von Yetis bevölkert sind wie der Himalaya“ (Beobachtungen, 257). So wollte es Neil Gaiman schreiben und das fiel bei mir auf fruchtbaren Boden.
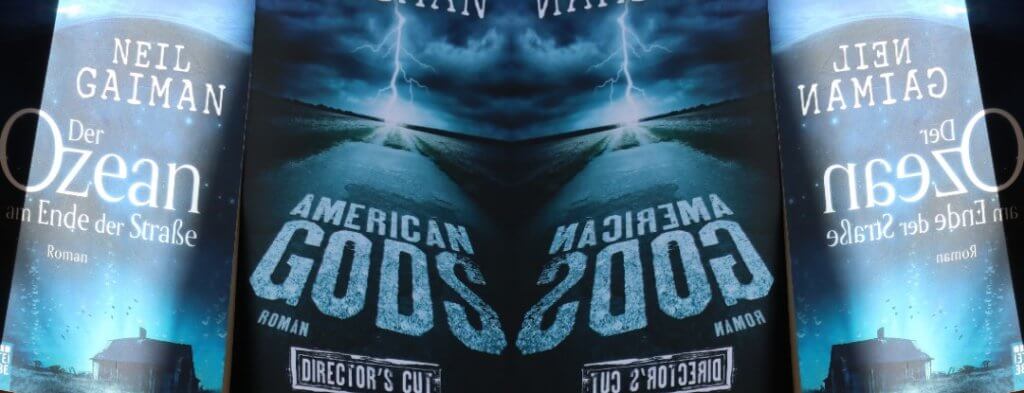
Ein kurzer Blick auf zwei weitere Werke über die Schaffensperiode hinweg zeigt, dass Neil Gaiman seinem Stil grundsätzlich treu geblieben ist, ihn vielleicht sogar noch verstärkt hat. Mir ist es bei diesen Büchern tatsächlich nicht mehr gelungen, die „Leerstellen“, das Mehr an Bedeutung mit eigenen Vorstellungen als Ganzes zu füllen.
Das bisher letzte Buch (2013) von Neil Gaiman ist vergleichsweise kurz. Bei einem Besuch an einem Ententeich taucht ein Mann wieder tief in die Ereignisse ab, die er als Siebenjähriger erlebt hat. Voller Gewalt, Grusel und einer tragischen Freundschaft; düster, stimmungsvoll und wirr. Ein Buch über „kindliche Hilflosigkeit“, über die „Unverständlichkeit der Erwachsenwelt“ und über die eigene Kindheit, die autobiographisch heraufbeschworen wird (Beobachtungen, 113).
Was soll ich sagen? Vielleicht war meine eigene Kindheit nicht unglücklich genug, um die gleichen Ängste empfunden zu haben. Vielleicht sind aber auch einfach die Themen und Bilder übergroß, fast zu bedeutungsschwer, sodass sie kippen und sich entleeren.
Zu viel weite Welt in einem kleinen Teich, zu viel Philosophie in der Seele eines Siebenjährigen, zu viel Allegorie für Sinniges. Der kleine Kindheits-Teich geht in der unendlichen Weite des Bedeutungs-Ozeans unter …
In überreichem Maße nutzt Neil Gaiman Mythen, Legenden, fantastische Elemente und Symbolik, was für manche wie ein „poetisches Juwel“ (Daniel Kehlmann) erscheinen mag, für mich aber einfach des Guten zuviel war, barock pompös, schön, aber ebenso abgeschmackt.
[➛ Eine ausführliche Rezension aus meiner Feder zu „Ozean am Ende der Straße“]
In dem Buch über die Götter der Amerikaner, das 2001 erschien, ist das Prinzip, Mythen in die Moderne zu packen auf die Spitze getrieben. Die alten, nordischen Götter sind in reale Figuren inkarniert und kämpfen gegen das Vergessen und die neuen Götter wie Internet und Fernsehen. „Der Roman ist der Versuch, mir Amerika zu erklären und zu verstehen“ (Gods, 8), sagt der Autor, und „viele der Schlüssel, die ich verwendet habe, um Amerika aufzuschließen, sind germanischen Ursprungs“.
Aha. Und warum sind die Hauptakteure Odin und Loki, obwohl die Wikinger nun gerade nicht zu den Einwanderern gehörten, die Amerika besiedelt haben (auch wenn sich die Angelsachsen das gerne so vorstellen)? Das ist seltsam eklektizistisch und nicht im Geringsten repräsentativ für die große Zahl an Einwanderern aus Europa, Asien, Südamerika und vielen anderen Ländern. Und deshalb kann es m.E. auch gar nicht in den Kern dessen vorstoßen, was Amerika in seinem Selbstverständnis ausmacht.
Der Roman ist ein großartiges Roadmovie, insofern durchaus amerikanisch, die Geschichte um die Hauptperson Shadow psychologisch interessant, aber gerade das Neuerzählen von nordischen Mythen im modernen Amerika funktioniert hier gar nicht, stört und bläht das Werk unnötig mit bezugsloser Bedeutung auf.
Schade.
[➛ Eine ausführliche Rezension aus meiner Feder zu „American Gods“]

Das Spiel mit der Bedeutung ist offensichtlich nicht leicht. Wenn die Leser*Innen die „Leerstellen“ füllen können mit der eigenen Geschichte, den eigenen Vorstellungen, dann funktioniert ein Roman. Wenn es zu viele einzelne Elemente gibt, die nur mit Bedeutung locken und kein Ganzes ergeben, zerbröselt die Geschichte und sie wird sinnlos.
Ich bin mir sicher, dass Neil Gaiman gerade deshalb so erfolgreich war, weil es ihm gelingt, eine filigran komponierte Erzähllinie zu gestalten, die hohe Stimmigkeit, Kohärenz, Sinnhaftigkeit schafft (oder suggeriert) und er gleichzeitig viele Angebote für die Anschließbarkeit des Leserhorizonts über bedeutungsoffene Elemente wie Mythen, Symbole, Bilder und mehr macht.
Das ist hohe Kunst.
Trotzdem: Um mein Urteil mit der Stimme des Meisters selbst zu intonieren: „Es gibt Dinge, die man bewundert und trotzdem nicht mag“ (Beobachtungen, 344). Tut mir leid.
Ein großer Kopf, unglaubliche Geschichten, faszinierende Welten, sympathische Ansichten, aber für mich einfach zu viel Herumexperimentieren und -tricksen mit nur scheinbar bedeutungsvollem Stoff, der sich oft als schal und wenig sinnig erweist.
Die Beschäftigung mit allen Büchern war es dennoch absolut wert. Die Beobachtungen aus der letzten Reihe haben mich am meisten begeistert, Niemalsland war eine berührende wie lebensechte Märchen-Fantasy, American Gods hartes mythologisches Kauderwelsch und der Ocean am Ende der Straße ein pompös inszeniertes Kindheitsdrama. Aber das mag natürlich an meinen begrenzten Bedeutungshorizont liegen …
Bleibt nur noch, einen Zauber auszusprechen, der unserem Halbheld Richard im Niemalsland widerfährt. Sinn-salabim: „Und hier ließen ihn die Metaphern im Stich. Er hatte die Welt von Verbildlichung und Vergleich hinter sich gelassen und war an einen Ort gelangt, wo die Dinge einfach nur sind, und das machte etwas mit ihm“ (324). Das wäre schön …
Neil Gaiman: Beobachtungen aus der letzten Reihe. Eichborn 2017 (2016), 563 Seiten.
Neil Gaiman: Niemalsland. Eichborn 2016 (1996), 431 Seiten.
Neil Gaiman: American Gods. Director´s Cut, Eichhorn 2015 (2001), 672 Seiten.
Neil Gaiman: Der Ozean am Ende der Straße, Bastei Lübbe 2016 (2013), 316 Seiten.
[Dieser Artikel ist auch im ➛Weltenportal Nr. 3 04/2022, S 79-83 (Hg. Christoph Grimm) erschienen.]
Weiterführende Links:
➛ Eine ausführliche Rezension zu „American Gods“
➛ Eine ausführliche Rezension zu „Ozean am Ende der Straße“
Geschichten sind immerhin Lügen. Geschichten erzählen von Menschen, die nie existiert haben, und von Dingen, die ihnen nie widerfahren sind. Warum also sollten wir sie lesen? Warum sollte uns das kümmern? (…)
Ideen, niedergeschriebene Ideen, sind etwas Besonderes. Sie sind eine Art, wie wir unsere Gedanken und Geschichten von einer Generation an die nächste weitergeben. Wenn wir das verlieren, dann verlieren wir unsere gemeinsame Geschichte. Dann verlieren wir viel von dem, was uns zu Menschen macht. Und Literatur schenkt uns Empathie. Sie versetzt uns in die Köpfe anderer und gibt uns die Möglichkeit, die Welt durch deren Augen zu sehen.
Literatur ist eine Lüge, die die Wahrheit erzählt, immer und immer wieder. (S. 215)
Neil Gaiman: Beobachtungen aus der letzten Reihe. Eichborn 2017 (2016)